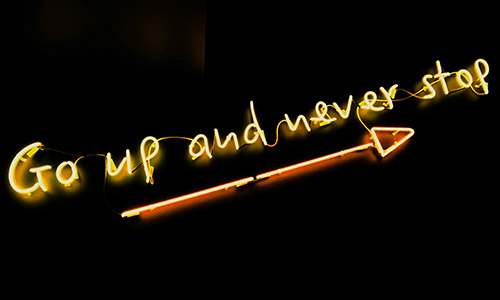Was Sie wissen sollten!
Kündigungsschutzklage
Wer nach seinem Empfinden zu Unrecht gekündigt wurde, sollte proaktiv vorgehen. Denn die meisten Beschäftigten genießen Kündigungsschutz und können sich mit einer Kündigungsschutzklage zur Wehr setzen. Ziel der Klage ist es, dass sich die Kündigung als unwirksam erweist. Schließlich muss der Arbeitgeber die Wirksamkeit der Kündigung beweisen.
Wem offensichtlich zu Unrecht gekündigt wurde, der sollte sich nicht davor scheuen, eine Kündigungsschutzklage anzugehen. Zum einen hat sie den Vorteil, dass sie in der Regel in einer Abfindung für den Arbeitnehmer mündet.
Zum anderen haben erkennbar ungerechtfertigte Kündigungen, gegen die man sich nicht wehrt, den Nachteil, dass das Arbeitsamt Konsequenzen daraus ziehen und im schlimmsten Fall eine zwölfwöchige Sperrzeit verhängen könnte. Eine Kündigungsschutzklage einzureichen, ist deshalb in den allermeisten Fällen in eine bewährte Option.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die wirksame Kündigungsschutzklage
Die Kündigungsschutzklage ist alternativlos und die beste Möglichkeit, gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber vorzugehen. Denn in einem Kündigungsschutzverfahren trägt grundsätzlich der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung rechtmäßig und verhältnismäßig war.

Ablauf einer Kündigungsschutzklage
Rechtsanwalt Dr. Schmid steht Ihnen für Ihre Fragen zum Arbeitsrecht zur Seite und vertritt Sie in Ihrer Rechtsangelegenheit vor Gericht. Rufen Sie uns gerne an, sodass wir einen ersten Beratungstermin vereinbaren können. Alternativ auch via E-Mail
Was Sie wissen sollten!
Kündigungsschutz-
klage
Wer nach seinem Empfinden zu Unrecht gekündigt wurde, sollte proaktiv vorgehen. Denn die meisten Beschäftigten genießen Kündigungsschutz und können sich mit einer Kündigungsschutzklage zur Wehr setzen. Ziel der Klage ist es, dass sich die Kündigung als unwirksam erweist. Schließlich muss der Arbeitgeber die Wirksamkeit der Kündigung beweisen.
Wem offensichtlich zu Unrecht gekündigt wurde, der sollte sich nicht davor scheuen, eine Kündigungsschutzklage anzugehen. Zum einen hat sie den Vorteil, dass sie in der Regel in einer Abfindung für den Arbeitnehmer mündet.
Zum anderen haben erkennbar ungerechtfertigte Kündigungen, gegen die man sich nicht wehrt, den Nachteil, dass das Arbeitsamt Konsequenzen daraus ziehen und im schlimmsten Fall eine zwölfwöchige Sperrzeit verhängen könnte. Eine Kündigungsschutzklage einzureichen, ist deshalb in den allermeisten Fällen in eine bewährte Option.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die wirksame Kündigungsschutz-
klage
Die Kündigungsschutzklage ist alternativlos und die beste Möglichkeit, gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber vorzugehen. Denn in einem Kündigungsschutzverfahren trägt grundsätzlich der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung rechtmäßig und verhältnismäßig war.

Ablauf einer Kündigungsschutz-
klage
Rechtsanwalt Dr. Schmid steht Ihnen für Ihre Fragen zum Arbeitsrecht zur Seite und vertritt Sie in Ihrer Rechtsangelegenheit vor Gericht. Rufen Sie uns gerne an, sodass wir einen ersten Beratungstermin vereinbaren können. Alternativ auch via E-Mail
Rechtssicher mit Teamkompetenz.
Derzeit besteht das Team der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Heinz Schmid aus zwei Vollzeitkräften und einer neuen Auszubildenden, die dafür sorgen, dass die Dinge rund laufen. Unsere wunderbaren Mitarbeiterinnen, die mich bei meiner Arbeit ausgezeichnet unterstützen, im Kurzprofil:

Sandra Dreiseitel
Dr. Schmids Miss Moneypenny
Die rechte Hand von Dr. Heinz Schmid ist ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte, von Anfang an dabei und bekannt dafür, dass sie „den Cent akribisch teilt.“ Bei komplizierten Fragestellungen läuft sie zu Höchstform auf. Schwierige Abrechnungen, Vollstreckungen und Zwangshypotheken nimmt sie sportlich! Sie meistert jede Herausforderung mit Bravour und unerschütterlicher Präzision.

Lorena Mannará
Generation Digital Native
Die junge Dame mit dem klangvollen Namen hat ihre Ausbildung in unserer Kanzlei mit Erfolg abgeschlossen. Lorena ist kommunikativ und offen und weiß sich für Neues zu begeistern, ist sie doch im digitalen Zeitalter aufgewachsen. Lorena spricht vier Sprachen, liebt den persönlichen Austausch mit anderen Menschen und hat ein herzliches und sonniges Gemüt. Kein Wunder! Bella Italia ist ihr Heimatland.
Gerechtigkeit wird nicht durch die Kraft des Gesetzes, sondern durch das Verständnis seiner Anwendung erreicht.
Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen.
Lassen Sie uns sprechen
Wir arbeiten täglich daran, dass Recht und Gerechtigkeit nah beieinander liegen. Unser Ziel ist es, im Umkreis von Ulm, Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis die Anlaufstelle für Fragen im Arbeitsrecht, Vertragsrecht sowie Baumaschinenrecht zu sein.
Melden Sie sich gern bei uns für ein erstes Beratungsgespräch. Wenn Sie mögen: Schildern Sie hier in aller Kürze Ihr Anliegen. Gerne können Sie uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns dann umgehend zurück.